Die Gämse zählt zu den faszinierendsten Wildtieren unserer Bergwelt. Sie ist optimal an das Leben im Gebirge angepasst. Doch der Klimawandel und menschliche Einflüsse verändern ihren Lebensraum. Die Alpenbewohnerin braucht jetzt mehr denn je ungestörte Rückzugsorte, an denen sie Ruhe finden und ihre Jungen aufziehen kann.
Felsiges Gelände und steile Hänge sind ihr Zuhause: Die Gämse ist ein wahres Hochgebirgstier. Dank ihrer spreizbaren Hufe und hartgummiartiger Sohlen schafft sie bis zu zwei Meter hohe und sechs Meter weite Sprünge und erreicht in abschüssigem Gelände bis zu 50 Stundenkilometer. Ihr außergewöhnliches Herz ermöglicht sportliche Höchstleistungen: Es ist ein besonders dicker Muskel mit einem sehr großen Volumen. Dadurch kann es bis zu zweihundert mal pro Minute schlagen. Das Blut hat einen sehr hohen Anteil roter Blutkörperchen, sodass die Gämse auch bei starker Anstrengung mit ausreichend Sauerstoff versorgt wird. In Deutschland kommen Gämsen vor allem in den Alpen vor, es gibt aber auch Populationen im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. In Österreich und der Schweiz sind sie weit verbreitet.
Im Energiesparmodus durch den Winter
Gämsen sind Pflanzenfresser. Im Sommer ernähren sie sich von Gräsern, Kräutern, Flechten und Moosen. Im Winter, wenn Schnee den Boden bedeckt, steht eine karge Kost aus Knospen und Trieben von Sträuchern und Bäumen auf dem Speiseplan. In dieser Zeit drosseln Gämsen ihren Stoffwechsel, um Energie zu sparen – eine bewährte Strategie, um die vegetationsarmen Monate zu überstehen. Die Tiere sind weniger aktiv und der Herzschlag verlangsamt sich. Allerdings fällt auch ihre Brunftzeit in den Winter. Gerade für die Böcke, die in Kämpfen um die Gunst der Geißen buhlen, ist die Paarungszeit anstrengend. Nach etwa sechs Monaten Tragzeit bringt die Geiß meist ein einzelnes Kitz zur Welt, das der Mutter schon kurz nach der Geburt in schwieriges Gelände folgt.

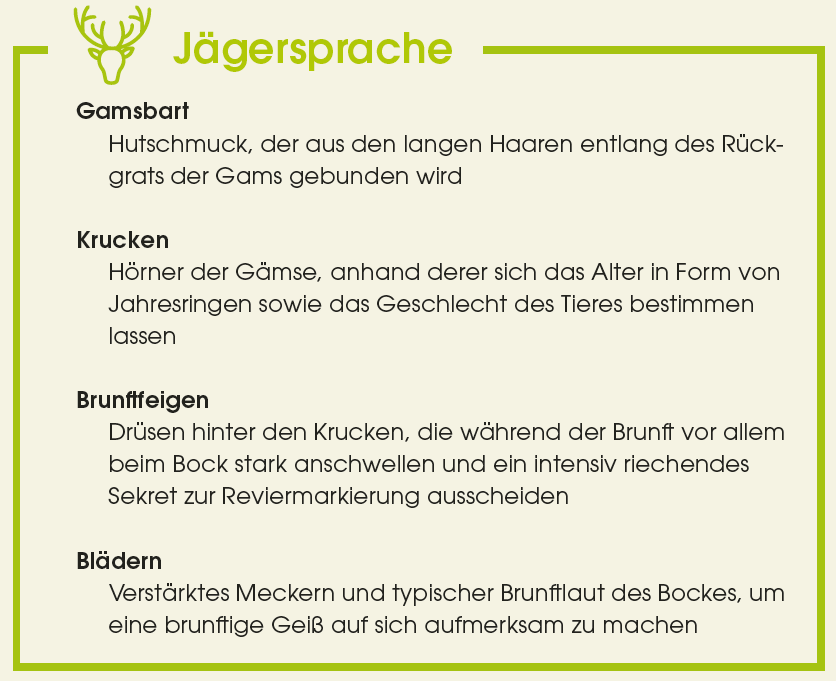
Zwischen Felswand und Forst
Gämsen sind typische Gebirgsbewohner, die sehr gut an die jahreszeitlichen Umweltbedingungen in ihrem Lebensraum angepasst sind. Im Sommer besiedeln sie die felsigen Hochlagen, Latschen- und Geröllfelder und alpinen Matten. Im Winter ziehen sie sich bei hohem Schnee in die Bergwälder zurück, wo sie mehr Nahrung finden können. Der Klimawandel, der in den Alpen besonders ausgeprägt ist, bricht dieses klare Bewegungsmuster zunehmend auf. Steigende Temperaturen im Sommer veranlassen vielerorts Gämsen, sich in die kühlen Bergwälder zurückzuziehen und tagsüber ihre Aktivität zu reduzieren. Auf diese Weise versuchen sie, Hitzestress zu vermeiden, der unter anderem zu einer verringerten Milchproduktion bei den Geißen führt und das Wachstum der Kitze verlangsamt. Das hat Einfluss auf die Entwicklung der Gämsenbestände, denn nur mit starken, fitten Nachkommen kann der Fortbestand der Art gesichert werden. Das Ausweichen in die Bergwälder bringt wieder andere Konflikte mit sich: Die Gefahr durch Prädatoren steigt, und Gebiete mit menschlichen Aktivitäten wie zum Beispiel Forstwirtschaft überlappen sich mit dem Lebensraum der Gämse. Im Wildtier-Webinar der Deutschen Wildtier Stiftung geht Wildtierbiologe Prof. Dr. Klaus Hackländer genauer darauf ein, warum der Lebensraum der Gämse immer kleiner wird und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt.

Mehr Ruhe für die Gämse
So anpassungsfähig die Alpenbewohnerin ist, so sehr braucht auch sie Rückzugsräume – besonders während der nahrungsarmen Zeit im Winter sowie der Aufzucht der Jungen im Sommer. Die Deutsche Wildtier Stiftung fordert seit langem die Ausweisung von Wildruhegebieten, wie sie in vielen europäischen Nachbarländern bereits existieren. Darüber hinaus sammelt sie, mit freundlicher Unterstützung von Frankonia, in Bayern Daten über die Gämse und ihre Lebensraumkonflikte, um für die Zukunft ein modernes, integratives Gamswildmanagement zu schaffen (Gämse – der Konflikt in Bayern | Deutsche Wildtier Stiftung).

Artenvielfalt bewahren
Die Gämse ist ein faszinierendes Beispiel dafür, wie sich Wildtiere auf extreme Herausforderungen in ihrem Lebensraum eingestellt haben. Dennoch ist ihr Bestand keineswegs gesichert, denn die Veränderung ihres Lebensraums, zum Beispiel durch den Klimawandel, aber auch durch direkte Eingriffe des Menschen, erfolgt schneller, als sich die Wildtiere anpassen können.
Sie wollen mehr über die Gämse wissen?
Das Wildtier-Webinar der Deutschen Wildtier Stiftung bietet Ihnen wissenschaftlich fundierte Einblicke in die faszinierende Wildart.
Oft erfüllen einzelne Arten ganz bestimmte, auf den ersten Blick kaum sichtbare Funktionen im Beziehungsgeflecht der Natur. Sicher ist, dass wir Menschen auf artenreiche Ökosysteme angewiesen sind – denn
nur sie bleiben widerstandsfähig. Hier können Sie spenden und aktiv dazu beitragen, die Artenvielfalt in Deutschland zu bewahren.
Text: Deutsche Wildtier Stiftung
Titelfoto: Im Sommer bekommt man die Gämse (Rupicapra rupicapra) häufig in den felsigen Hochlagen zu Gesicht. Auf den ersten Blick sind Männchen und Weibchen nicht leicht voneinander zu unterscheiden. Beide tragen Hörner sowie die charakteristische Gesichtsmaske mit einer Längsbinde, die von den Ohren über die Augen bis zur Nase verläuft. (Foto: imageBROKER.com / Bernd Zoller)




